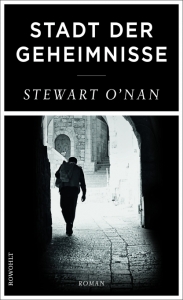Nach einem Alleingang mit ihrem Team, bei dem ein Kollege tödlich getroffen wird, wird die DGSE Kommissarin Christine Steiner zunächst beurlaubt. Die Zeit soll sie auch nutzen, um den Selbstmord ihrer Mutter zu verarbeiten. Obwohl privat unterwegs bittet ihr Chef sie, bei einem Einsatz in Lyon zu unterstützen. Dort wurde ein älteres deutsches Ehepaar ermordet, ehemalige Mitglieder einer linksextremen Gruppierung, auf die ein deutsch-französisches rechtes Bündnis offenbar gerade Jagd macht. Als Christine den Tatort inspiziert, findet sie etwas, das sie völlig aus der Bahn wirft: ein Foto, auf dem ihre Mutter und sie als Kleinkind zu sehen sind. Ihre Mutter hatte nie darüber gesprochen, weshalb sie 1971 alle Brücken zu ihrer deutschen Heimat abgebrochen hat. Christine benötigt nicht viele Informationen, um sich schon kurz danach auf den Weg nach Leipzig zu machen und Rache zu nehmen.
Es gibt Autoren, zu deren Büchern man greift, ohne auch nur einen kurzen Blick auf den Klappentext zu werfen. Jérôme Leroy zählt für mich zu diesen, Max Annas konnte mich bislang gleichermaßen begeistern. Eine Kooperation von beiden ist daher etwas, das ich mir kaum entgehen lassen konnte. „Terminus Leipzig“ ist im Rahmen des Krimifestivals „Quais du Polar“ zwischen den beiden Autoren und ihren Verlagen Edition Nautilus aus Deutschland und Le Point aus Frankreich entstanden. Wie auch in ihren anderen Romanen wird die Handlung von gesellschaftspolitischen Ereignissen getragen, hier der gegenwärtige Terrorismus, der mit der linksextremen Gewalt in der Bundesrepublik der 1970er geschickt verbunden wird.
Als Leiterin einer Antiterroreinheit ist Christine unerschrocken und strategisch in ihrem Vorgehen. So akribisch sie sich über ihre Zielpersonen informiert, hat sie die fehlenden Informationen über ihre eigene deutsche Herkunft immer hingenommen und die Mutter nie genötigt, etwas über ihre Zeit vor dem Umzug in die französische Provinz zu berichten. Das Foto vom Tatort lässt jedoch kaum andere Schlüsse zu als dass die unauffällige Krankenschwester offenbar eine extremistische Vergangenheit hat. In Wolfgang Sonne, der ebenfalls zu sehen ist, glaubt Christine ihren Vater zu erkennen, weshalb sie sich auf den Weg zu ihm macht, um Antworten auf die bislang nie gestellten Fragen zu erhalten. Doch dafür bleibt kaum Zeit, denn gerade in Leipzig angekommen, geraten sie in das Feuer der Rächer, die Sonne ebenfalls ausfindig gemacht haben.
Ein rasanter Kurzkrimi, der sich nicht lange mit der Figurenentwicklung aufhält, sondern unmittelbar ins Geschehen einsteigt. Eine vielversprechende Zusammenarbeit der beiden Autoren, die für mein Empfinden noch stärker hätte ausgebaut werden können, denn sie reißen nur an, was sie eigentlich können. Auch die Handlung bietet noch Entwicklungsspielraum, womöglich ist dies ja in dem Cliffhanger am Ende angelegt, wünschen würde ich mir das jedenfalls.