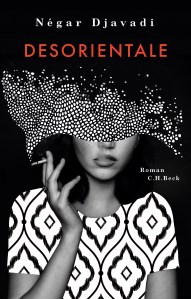Drei Frauen, drei Schicksale. Esha konnte sich ihren Traum verwirklichen: dank des wohlhabenden und gebildeten Hintergrundes konnte sie der Provinz Westbengalen entfliehen und ihr Glück in Frankreich suchen. Doch Paris hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Die Kinder in der Schule, in der sie als Englischlehrerin arbeitet, verachten sie, Freunde oder gar einen Partner hat sie ebenfalls nicht gefunden. Nach Hause will sie aber unter keinen Umständen zurückkehren, schon die Telefonate mit ihrer Mutter sind ihr zuwider. Sie hofft auf die französische Staatsangehörigkeit, um dauerhaft Asien den Rücken kehren zu können. In Paris hat sie Marie kennengelernt, die ebenfalls aus Indien stammt, aber bereits als Kind adoptiert wurde und in Frankreich aufwuchs. Nun als junge Erwachsene sucht diese nach ihren Wurzeln und bereist das unbekannte Herkunftsland. Schnell engagiert sie sich dort auch für die Unterdrückten und nimmt an Protestaktionen teil, auch wenn sie oftmals nicht versteht, was wirklich dahintersteckt und wie sich das Leben eines einfachen Arbeiters gestaltet. Ein Leben wie es die Analphabetin Mina führt. Die Hoffnung auf Verbesserung ihrer Lage hat sie schon längst aufgegeben, bleibt nur noch die auf die Heirat mit Sam, den sie schon als Baby liebte. Doch Sam hat andere Pläne und Minas Schwangerschaft soll nicht sein Problem sein.
Wie auch in ihren anderen Romanen scheut sich Shumona Sinha nicht, unpopuläre Themen aufzugreifen und den Finger in die Wunde zu legen. Dieses Mal geht es im Wesentlichen um die Rolle der Frau bzw. ihr Ansehen in der Gesellschaft und um den Platz, den die französische Gesellschaft den Einwanderern zuweist. Sie kommen nie wirklich in der Mitte der Gesellschaft an, bleiben am Rand, unter sich, was sich vor allem auch räumlich ausdrückt:
Sie lebte am Ende der von Tankstellen, Autovermietungen und chinesischen Imbissläden gegliederten Straße, mit Menschen unterschiedlichster Herkunft, die sich an dieses Ende klammerten wie an den Schwanz einer langsamen, müden Schlange, deren Leben sich weiter oben abspielte.
Unsichtbare und unüberwindbare Mauern trennen die Schichten in jeder Hinsicht. Obwohl Esha in Paris mehr Freiheiten genießt als in Kalkutta, muss sie doch recht schnell feststellen, dass auch hier Werte und Normen ihr Leben einschränken:
Während es in Indien für eine alleinstehende Frau unmöglich war, eine Wohnung zu mieten, hatte sich hier niemand daran gestört, als sie ihren ersten Mietvertrag unterschrieben hatte. Die Probleme hatten danach angefangen. Schnell war aufgefallen, dass sie alleine lebte. Dass sie frei war, bedeutete, dass sie es für alle war, ihre Freiheit war nicht ihre Angelegenheit, sondern die der anderen und wurde bedroht von dem Verlangen der Männer und dem Misstrauen der Frauen.
Es scheint ein Naturgesetz zu sein, dem sie nicht entfliehen kann.
Die Abwesenheit eines Kindes ersparte ihr nicht die Fragen über dieses ungeborene Kind. Man wollte wissen, ob sie unfruchtbar sei, ob sie schon in den Wechseljahren sei, und vor allem hatte man sie in Verdacht, nicht richtig geliebt zu werden. Ein Kind zu haben, war genauso wichtig wie eine Arbeit, ein Haus, ein Auto zu haben. Sie war OfW, ohne fürsorgliche Weiblichkeit.
Sie wird daran gemessen, ob sie ihrer Pflicht als Frau nachkommt und Nachwuchs hervorbringt. Ihre intellektuellen Fähigkeiten treten völlig dahinter zurück und werden von dieser drängenden Frage überlagert. Wird sie nicht auf das Muttersein reduziert, muss sie sich vor anzüglichen Blicken und Übergriffen schützen, als Asiatin wird sie insbesondere schnell in die Ecke einer Prostituierten geschoben, die für Männer frei verfügbar sind. Oder man hält sie für eine Asylbewerberin, Sozialschmarotzerin, die sich in der Metro öffentlich dafür rechtfertigen soll.
Schlimmer als Esha trifft es jedoch Mina in Indien, Sie versucht den Kampf für die richtige Sache, wird sich aber schnell der Grenzen bewusst, die man einer Frau wie ihr setzt. Auch ihr Vater kennt die Regeln der Gesellschaft und muss entsprechend handeln:
Verzeih mir, meine Kleine, aber du musst unser Haus verlassen. Du musst uns verstehen, wir haben keine andere Wahl, uns sind die Hände gebunden, wenn du bleibst, verstoßen sie uns alle, dein Bruder kann dann nicht mehr für diese Leute arbeiten, wir können nicht mehr auf die Straße gehen.
Die Schuld an ihrer Schwangerschaft tragen beide, Mina und Sam, doch nur sie wird zur Rechenschaft gezogen und der Verstoß durch die Familie wird noch nicht alles sein. Der Wert eines Frauenlebens geht gegen null.
Es gäbe unheimlich viel mehr zu sagen und zitieren aus dem kurzen Roman, der auf den rund 160 Seiten sowohl die vermeintlich fortschrittliche westliche Welt mit der vermeintlich rückschrittlichen bäuerlichen Gesellschaft in Westbengalen kontrastiert und man letztlich ebenso wie Esha erkennt, dass Diskriminierung überall ein inhärenter Teil der Strukturen ist und dass es gerade für Frauen ein schmaler Grat sein kann zwischen akzeptablem Verhalten und Verachtung:
Der Körper der Frau, verschleiert oder unverschleiert, löste hier wie anderswo heftige Reaktionen aus. Ein paar Zentimeter Stoff, hier waren sie zu viel, anderswo zu wenig.