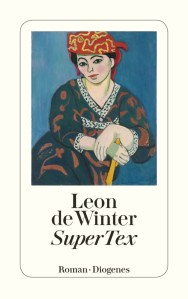Sarah, die Erzählerin, befindet sich in einer exklusiven Londoner Klinik. Während Dr Seligman sie behandelt, sprudelt es geradezu aus ihr heraus. Es wird ein intimes Geständnis über ihre Beziehungen, ihre Sexualität, die schwierige Beziehung mit ihrem Psychologen Jason, aber auch ihre Obsession mit Hitler und den Nazis; über die Scham, die sie als Frau, als Tochter, als Deutsche empfindet. Es gibt kein Tabu, das sie bei diesem Termin nicht bricht, kein Vorurteil über ihre Heimat, das sie nicht leichter Hand vom Tisch wischt. Eine Konsultation der anderen Art.
„Ich will Sie nicht provozieren, Dr. Seligman, erst recht nicht hetzt, da Sie ihren Kopf zwischen meinen Beinen haben, aber (…)“
Genau das ist es jedoch, was die deutsche Autorin Katharina Volckmer, die in London lebt und ihren Debutroman „Der Termin“ in englischer Sprache verfasste, erreichen möchte. In Interviews betont sie stets, dass ihr Text auf Deutsch und für ein deutsches Publikum nicht funktioniert. Zu sehr wären Leser schockiert von den Offenbarungen und der Abrechnung mit der fehlgeschlagenen Vergangenheitsbewältigung, die sich hinter der Prüderie und Pedanterie verstecke.
Es ist vor allem die Verbindung von Holocaust und Sexualität, die irritiert. Dass die Erzählerin ein Fetisch für Männer hat, die sie dominieren, unterwerfen, ausnutzen, missbrauchen, ist eine Sache. Ob ihr Wunsch nach Transition aus dem Gedanken, den totgeborenen Bruder ersetzen zu wollen – sie, die Nachgeburt, der übrig geblieben Zellhaufen – resultiert, bleibt unklar. Keine Zweifel gibt es jedoch daran, dass sie in ihrer eigenen Wahrnehmung als Tochter den elterlichen Erwartungen nie gerecht werden konnte und dass sie zu der Erkenntnis gekommen ist, als Frau immer nur Mensch zweiter Klasse zu sein.
Bewusst fordert sie den jüdischen Arzt heraus, will ihn schockieren, ihn, der geschichtsbedingt auf der anderen Seite steht, keine Schuld mit sich trägt wie sie, für ewig die Absolution erhalten hat und über jeder Form von Anschuldigung steht. Dies erlaubt es ihm auch zu schweigen, er scheint zwar Fragen zu stellen, doch werden diese nicht widergegeben und könnten ebenso schlicht Sarahs Gedankenfluss entspringen.
Ob das Buch wirklich tiefgründig ist oder doch nur oberflächlich reizen möchte, ist tatsächlich schwer zu sagen, immerhin hat der Roman in der internationalen Presse viel Aufmerksamkeit erhalten. Die Frage danach, was die eigene Identität ausmacht, inwieweit Erziehung insbesondere bezogen auf das Geschlecht und damit verbundene Erwartungen formen bzw. inwieweit die Geschichte unserer Familie, unseres Landes sich auswirkt, eine andere. Bisweilen schwer zu ertragen ob der brutalen und schamlosen Wortwahl – umgekehrt mit dem Schluss des Kreises, indem sie am Ende wieder zu ihrem Ausgangsthema, den Nazis und ihre eigene familiäre Schuld, zurückkehrt, jedoch überzeugend konstruiert.