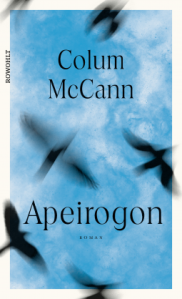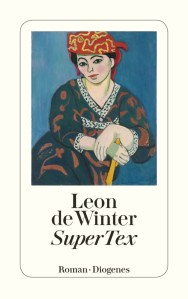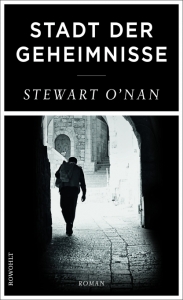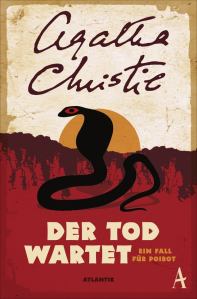
Eigentlich will Hercule Poirot nur das Fenster seines Hotelzimmers schließen, als er einen kurzen Dialog mitanhört, bei dem es ganz offenkundig darum geht, eine Frau zu töten. Genau das ist auch einige Tage später unweit der alten Ruinenstätte Petra der Fall: die alte Mrs Boynton, die ihre Familie tyrannisierte und für die Reisegesellschaft eine Qual darstellte, wird tot aufgefunden. Dr. Gerard, der sich zufällig am selben Ort aufhält, kommen Zweifel am natürlichen Tod, weshalb Poirot hinzugebeten wird. Dieser kündigt an, innerhalb von nur 24 Stunden das Mysterium lösen und den Mörder präsentieren zu können.
„Der Tod wartet“ ist bereits der 18. Fall für den belgischen Meisterdetektiv, den Agatha Christie dieses Mal lange Zeit nur am Rand der Handlung erscheinen lässt. Im Vordergrund steht Familie Boynton, die jedoch immer nur durch die Augen von Sarah King, einer jungen britischen Ärztin, und dem französischen Psychologen Dr. Gerard beschrieben werden, die sich zufällig in demselben Hotel in Jerusalem und später in dem Beduinenlager bei Petra aufhalten. Poirot löst den Fall, in dem er akribisch alle Beteiligten befragt und in gewohnter Manier Unstimmigkeiten offenlegt und die richtigen Schlüsse zieht.
Die Schilderungen der tyrannischen Matriarchin im Hotel und auf der Reise bieten quasi allen Figuren ein Mordmotiv. Die drei Stiefkinder Raymond, Carol und Lennox nebst seiner Frau Nadine werden systematisch unterdrückt und von Fremden ferngehalten. Die Mutter verfügt über das Geld der Familie und hat den Ton, den sie sich einst als Gefängniswärterin aneignete, auch bei der Erziehung der Stiefkinder beibehalten. Ihre eigene Tochter Ginevra ist inzwischen so weit der Realität entrückt, dass sie die Unterdrückung kaum mehr wahrnimmt. Sarah King und Dr. Gerard beunruhigt, was sie beobachten, auch dem Freund der Familie, Jefferson Cope, scheint nicht wohl bei dem zu sein, was seine alte Freundin den jungen Menschen antut. Die Lage spitzt sich in dem heißen Wüstenwetter immer weiter zu, so dass der Mord nicht weiter verwunderlich ist.
Auch wenn außer Frage steht, dass es hier zu einer heimtückischen Tötung kam, wird doch auch die Frage angerissen, ob man gemessen an dem, was die Kinder und potentiellen Täter erdulden mussten, von einer klassischen Schuld reden kann oder ob das Ableben nicht notwendig war, damit viele andere Personen leben konnten.
Eine gemeinschaftliche Tat kommt ebenso infrage wie der mutige Schritt eines einzelnen, man glaubt nur noch kleine Details von der Lösung entfernt zu sein, als Agatha Christie einmal mehr überrascht. Ein kurzes Vergnügen, auch wenn man einräumen muss, dass die Erzählweise mit zahlreichen Redundanzen und Wiederholungen etwas der Mode gekommen ist. Ein typischer Poirot, der vollends die Erwartungen bedient.