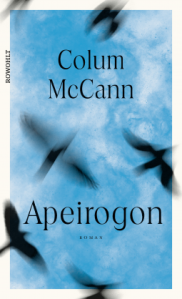Gerade hat ihr Freund ihr auf dem Empire State Building einen filmreifen Heiratsantrag gemacht und sie das perfekte Loft gefunden, als es sie aus heiterem Himmel trifft. Ein Blick genügt und um sie und den neuen Nachbarn ist es geschehen. Zunächst nur freundliches Grüßen, gestohlene Blicke hier und da, aber sie wissen beide sofort, dass dies nicht lange so bleiben wird. Doch sie ist verlobt, der Hochzeitstermin steht, er hat Frau und eine kleine Tochter. Aber das, was sie verbindet, ist stärker und so beginnen sie eine Affäre. Heimliche Treffen, gemeinsame Nachmittage und Nächte. Aber es ist klar, dass dies nicht lange gutgehen kann. Bis er sich entscheiden muss. Und dies tut. Oder auch nicht.
« Il en fait ce qu’il veut. Il la quitte, il la reprend, il la jette, il la rattrape d’un doigt. Elle dit oui. À tout et à n’importe quoi. Elle dit oui parce qu’elle est incapable de dire non. »
Géraldine Dalban-Moreynas Romandebüt wurde 2019 mit dem „Prix du premier roman“ als bestes Erstlingswerk junger Autoren ausgezeichnet. Die Geschichte zwischen der Journalistin und dem Anwalt ist keine Liebesgeschichte, es ist eine Amour fou, eine Obsession, die die Figuren in einer Bubble leben lässt, die die Außenwelt ausblendet und sie blind macht. Eine gegenseitige Abhängigkeit, die stärker ist als alle Drogen und einen klaren Kopf und Entscheidungsfähigkeit ausschließt.
« Jalousie absurde. L’histoire est absurde. L’amour est absurde. »
Die Geschichte wird aus Sicht der Journalistin erzählt, die eigentlich von einem biederen Leben der Pariser Mittelschicht träumt – Mann, Kind, hübsche Wohnung mit all den unnützen Gegenständen, die man eben so besitzt, aber nie benötigt –und die völlig von ihren Emotionen überrannt wird. Nach Wochen und Monaten des heimlichen Zusammenseins muss das böse Erwachen kommen. Und mit diesem kommt auch der Schmerz.
« Elle se dit que chaque fois la douleur a été plus violente. Elle n’ose imaginer la prochaine fois. »
Er liebt seine Noch-Ehefrau nicht mehr, ohne Frage, aber er liebt seine Tochter, die er nicht aufgeben will. Trennt er sich, verliert er auch sie. Eine Entscheidung, die er nicht treffen kann. Und sie leidet. Jedes Mal mehr. Aus Liebe wird Qual, so hoch sie fliegen, wenn sie zusammen sind, so tief ist der Fall und so hart ist der Aufschlag, wenn er ins eheliche Nest zurückkehrt. Ewig könnte dies weitergehen, außer ein dramatischer Einschnitt kommt. Und das tut er.
Es ist keine Liebesgeschichte, bei der man mit den Figuren liebt und ein wenig leidet und weiß, dass das Happy-End unweigerlich kommt; die Figuren bleiben dadurch, dass sie nicht einmal Namen haben, ein bisschen fern, was aber die Intensität ihres Leids auch abmildert, diese wäre vor allem im letzten Drittel auch kaum mehr auszuhalten. Auch wenn der Titel Gegenteiliges behauptet, man ist sich zwischendurch nicht sicher, dass die Protagonisten diese Obsession überleben. Géraldine Dalban-Moreynas schreibt intensiv und es gelingt ihr so, die Geschichte greifbar und für den Leser auch durchaus fühlbar zu machen.