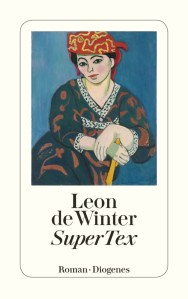Die drei Kinder der Familie Popper könnten kaum verschiedener sein. Als die Mutter stirbt, wird dies dem Lebemann Serge, dem ewig unentschlossenen Jean und ihrer kleinen Schwester Nana bewusst. Auch ihre Wurzeln kennen sie nicht, weshalb der Vorschlag von Serges Tochter Joséphine, nach Auschwitz zu fahren und die Spuren der mütterlichen Verwandtschaft zu erkunden, aufgegriffen wird. Ein Familienausflug ins Vernichtungslager – diese absurde Konstruktion kann nur der Meisterin der zwischenmenschlichen Eskalation einfallen.
Yasmina Reza erspart ihren Figuren auch in „Serge“ nichts. Ein gänzlich unjüdische Familie, die alle Konflikte eskalieren lässt und sich auch am schlimmsten Erinnerungsort Europas nicht davon abhalten lässt. Weshalb die Autorin dem ältesten Bruder die Ehre der Titelgebung gemacht hat, bleibt für mich indes unklar, denn erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive Jeans, der immer zwischen den Geschwistern stand und so ganz natürlich die Rolle des Vermittlers und Schlichters bekommen hat, die er aber nur mäßig ausfüllen kann.
„Souviens-toi. Mais pourquoi ? Pour ne pas le refaire ? Mais tu le referas. Un savoir qui n’est pas intimement relié à soi est vain. Il n’y a rien à attendre de la mémoire. Ce fétichisme de la mémoire est un simulacre. “
Der Tod zieht sich in unterschiedlichen Facetten durch das Buch. Erst der Verlust der Mutter, dann, im Zentrum des Romans, der Besuch in Auschwitz. Bemerkenswert, wie hübsch der Bürgermeister im Übrigen die Stadt mit Blumen hergerichtet hat. Die Erinnerung an den Holocaust wird auch von der kleinen Reisegruppe in all ihrer Absurdität zelebriert. Sich an etwas erinnern, das man gar nicht erinnern kann, Menschen gedenken, die man nicht kennt. Und eigentlich sind es doch eher die weltlichen Dinge, die mehr interessieren.
Reza gelingt es einmal mehr, ähnlich wie ihrem Landsmann Michel Houellebecq, den Finger in eine Wunde – hier: die französische Erinnerungskultur, nicht nur bezogen auf den Mord an Millionen Juden, sondern auch an jüngste Opfer von Anschlägen – zu legen, sondern gleichzeitig auch den feinen Sarkasmus und Ironie französischer Komödien in derselben Geschichte unterzubringen. Sprachlich wie gewohnt ausgefeilt und ein Genuss zu lesen.
Zwar fand ich „Serge“ insgesamt etwas schwerer zugänglich als beispielsweise den „Gott des Gemetzels“ oder „Kunst“, aber vielleicht benötigt der Roman auch einfach nur etwas mehr Raum zum Wirken. Lesenswert ist er ganz ohne Frage.