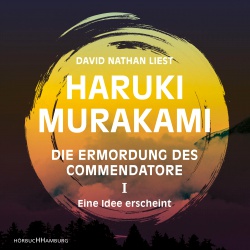Keiko Furukura ist mit sich und ihrem Leben eigentlich im Reinen. Als Studentin hatte sie bereits in einem Konbini, einem 24-Stunden-Supermarkt, angefangen und auch 18 Jahre später arbeitet sie immer noch dort als Aushilfe. Ihr ganzes Leben richtet sich nach dem Takt des Markes, in ihrer Freizeit ruht sie sich aus, um für ihren Einsatz wieder fit zu sein und unzählige Chefs und neue Mitarbeiter hat sie kommen und gehen sehen, sie selbst wurde zum Gesicht ihres Marktes. Als sie Shiraha wiedertrifft, der als Aushilfe ihr Kollege war, wegen seiner zahlreichen Verfehlungen aber nach kurzer Zeit bereits wieder gehen musste, wird dies ihr Leben verändern. Sie nimmt den obdachlosen Mann mit in ihre kleine Wohnung, nicht ahnend, dass sie ihn nicht so einfach wieder loswerden würde und dass ausgerechnet dieser Taugenichts ihren Lebensentwurf ins Wanken bringen würde.
Aus westlicher Sicht mutet vieles in diesem Roman sehr befremdlich an, die Werte und Normen der japanischen Gesellschaft weichen doch sehr stark von den unseren ab und lassen einem mit Verwunderung auf sich manchen Dialog blicken. Dies ist jedoch auch der interessante und spannende Aspekt des Romans, der so einen Einblick in diese fremde Welt ermöglicht und das beleuchtet, was von außen nicht so offensichtlich ist.
Das erste, was einem irritiert, ist Keikos absolute Verbindung mit ihrer Arbeit. Dies kann an sich bei uns genauso vorkommen, doch sie ist nur eine Aushilfe, noch dazu in einem Supermarkt, wofür sie mit ihrem Universitätsabschluss völlig überqualifiziert ist. Dass sie so in dieser Arbeit aufgehen kann, ist nicht einfach nachzuvollziehen und vor allem, dass dies sich auch in einem solchen Maß auf ihr Privatleben ausdehnt, das sie explizit zur Regenerierung für ihre Arbeit gestaltet.
Der zweite verwunderliche Aspekt war für mich die gesellschaftliche Bewertung der Menschen. Es gibt akzeptable Lebensentwürfe, die sich aber für die beiden Geschlechter auch stark unterscheiden, alle anderen werden recht rigoros abgelehnt. Dass Keiko eine Arbeitsstelle hat und mit ihrem Einkommen ihr Leben offenbar problemlos bestreiten kann, ist dennoch wegen ihres Status als Aushilfe nicht hinnehmbar. Wäre sie verheiratet, würde dies wiederum akzeptiert werden. Die Definition über den Job und die Art der Anstellung als Grundlage für das gesellschaftliche Ansehen muten sehr befremdlich und für die heutige Zeit ausgesprochen rückständig an.
Am meisten jedoch hat mich verwundert, wie die eigentlich unabhängige Frau, die ihr Leben im Griff hat und im Reinen mit sich und ihrer Situation ist, so schnell unter dem Einfluss eines Mannes geraten kann, ihre eigenen Bedürfnisse verleugnet und sich ausnutzen lässt. Shiraha ist ein Schmarotzer, anders kann man es wohl kaum ausdrücken, doch sie lässt ihn gewähren, ordnet sich ihm in ihrer eigenen Wohnung unter und befolgt seine Anweisungen. Kurzzeitig scheint man die Motivation – das vorgeblich geregelte Leben an der Seite eines Mannes, was für eine Frau mit Mitte 30 der einzig akzeptable Zustand zu sein scheint – nachvollziehbar, doch sie kann diese Rolle gar nicht ausfüllen und scheitert im Prinzip vom ersten Tag an daran.
Ein insgesamt sehr japanischer Roman, der gesellschaftliche Mechanismen ebenso offenlegt wie den Arbeitsethos, der sich drastisch von unserer Work-Life-Balance Diskussion unterscheidet. Zwar sind die Figuren auch dort weitgehend Außenseiter, dennoch bieten sie ausreichend Projektionsfläche für einen kurzen Blick auf so manche schiefe Entwicklung.