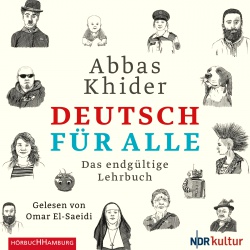Eine Stadt irgendwo im Westen der Republik. Amal ist nicht das Mädchen, wie man es von ihr erwartet; von klein auf verbringt sie mehr Zeit mit den Jungs, kleidet sich wie sie und schneidet sich radikal die Haare ab. Immer wieder kommt es zu Konflikten, die sie gerne auch mit Gewalt löst. Ihr Vater steht trotzdem zu ihr, bis er eines Tages nach Kurdistan verschwindet und die Mutter mit den beiden Kindern allein zurücklässt. Das Verhältnis zwischen Amal und ihr wird schwieriger, die Mutter zieht sich ob der Schmach des Verlassenwerdens zurück und versteckt sich unter dem Kopftuch, während Amal fasziniert von Shahira, der Mutter ihres Freundes Younus, ist. Doch im Viertel zerreißt man sich das Maul über die Frau, die sich in kurzen Röcken und figurbetont kleidet. Auch Raffiq fühlt sich von ihr angezogen, auch wenn er als Jugendlicher eigentlich Amals Freund ist. Alle drei Heranwachsende, Amal, Younus und Raffiq teilen noch etwas anderes: das Aufwachsen in einem Land, das die Eltern zum Teil enttäuscht hat, in dem sie nicht angekommen sind, wo das Leben wie von der Stopptaste angehalten verläuft. Für ihre Kinder sehen sie die Zukunft in der Heimat, Kurdistan, doch diese haben andere Pläne.
In ihrem zweiten Roman fängt Karosh Taha die Lebenswelt vieler Migranten lebhaft und vielschichtig ein. Die Identitäten, die geradezu gespalten scheinen zwischen dem kurdischen und deutschen Ich; die Sitten und Kulturen der beiden Länder, die sich oftmals diametral entgegengesetzt stehen; die Familien, die alle verschieden sind und doch die gleichen Sorgen und Rückschläge teilen; Vorurteile, die es nicht nur von den Mitgliedern der anderen Kultur, sondern ganz stark auch innerhalb der eigenen Community gibt.
Trotz des spannenden und komplexen Themas konnte mich das Buch nicht wirklich packen. Im ersten Teil erzählt Amal aus ihrer Sicht, im zweiten wird sie von Raffiq abgelöst, aber so richtig wollen sie nicht ineinandergreifen. Hin und wieder erscheint der Text auch als regelrechter Stream of Consciousness, mit unzähligen Schleifen und Wiederholungen, was jedoch mehr zu einer hohen Redundanz denn zu einem Erkenntnisgewinn führt und bisweilen fast langatmig wird. Amal kommt als Figur noch differenzierter daher, wie sie kämpft um die Aufmerksamkeit des Vaters, mit der Rollenerwartung an sie als Mädchen hadert, die beiden Rollenmodelle Mutter und Shahira immer wieder abwägt und letztlich bei einem Besuch in Kurdistan, doch auch nur erkennt, wer sie nicht ist, aber nicht, wer sie ist. Raffiq ist mir in seiner Schwärmerei für Shahira und der tatsächlich doch oberflächlich geführten Auseinandersetzung mit den Eltern thematisch zu eng. Younus hätte sicher auch eine interessante Perspektive und Einblicke geboten, wird jedoch nur in der Außensicht durch die anderen präsentiert.
Ein schwer zu greifender Text, der mich leider emotional nicht berührt hat, obwohl gerade Protagonistin das Potenzial gehabt hätte, ihre spezifische Situation begreifbar zu machen.